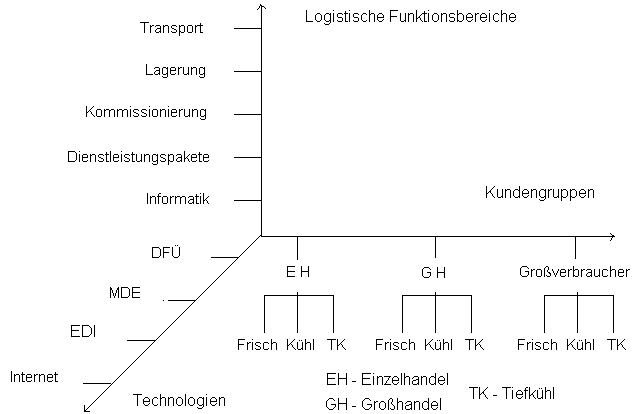
| III. Strukturierung des Marktes der Eigendistributeure | ||
Nieschlag, Dichtl und Hörschgen folgend, kann man annehmen, daß
"(...) insbesondere das Konzept der subjektiv empfundenen Substituierbarkeit die Möglichkeit valider Marktabgrenzung unter Marketing-Gesichtspunkten bietet, da letztlich weniger die materielle oder funktionale Beschaffenheit eines Produktes als vielmehr die Reaktion der potentiellen Abnehmer auf das gesamte Angebot des Unternehmens über dessen absatzwirtschaftliche Zielsetzung entscheidet." (Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1991, S. 624.)
Der relevante Markt ist immer in seiner Dynamik, in seiner Entwicklung zu begreifen, weil das Wirtschaftsgeschehen ständig die Konstellation der Marktteilnehmer und der ausgetauschten Produkte ändert. Zur Bestimmung der Marktstellung der Eigendistributeure gehören z.B. Angaben über die räumliche Verteilung ihrer Standorte, über die Preise für ihre Marktleistungen, über die angewandten Technologien, Herstellungskosten, Finanzlage, Organisation, Qualität der Mitarbeiter, Stärke der Konkurrenten usw.
Um die Strukturierung des relevanten Marktes vorzunehmen, muß man vor allem das gehandelte Marktgut identifizieren. Ferner sind dessen jetzige, und auch seine potentiellen Hersteller, die Abnehmer, und ihre Marktstellung, die Substituierbarkeit, und die Eigenschaften der Produkte, Teilmärkte und Kriterien ihrer Abgrenzung zu bestimmen. Dabei kann man auf verschiedene Ansätze der Marktabgrenzung zurückgreifen, z.B. auf(Steffenhagen 1991, S. 45f.):
- nachfragerbezogene,
- bedürfnisbezogene und
- technologisch-gutsbezogene Ansätze..
Es ist jedoch nicht möglich, ein allgemeingültiges, universell anwendbares Kriterium zu nennen, sondern es ist im Gegenteil "(...) aus der - streng genommen - kontinuierlichen Abstufbarkeit zwischen enger und weiter Marktabgrenzung erkennbar, daß keine verbindliche Norm für die Abgrenzung von Märkten existiert. Stets ist die Abgrenzung vom Betrachtungszweck desjenigen abhängig, der eine Marktuntersuchung plant." (Steffenhagen 1991, S. 47.)
In der vorliegenden Arbeit dienen die Kriterien der Abgrenzung von Teilmengen des Marktes, auf dem die Eigendistributeure agieren, zur Darstellung der Struktur dieser Unternehmen. Als Instrument der Analyse kann das Konzept der Geschäftsfelder von Abell angewandt werden.
III.1. Marktstrukturierung nach dem Konzept der Geschäftsfelder von Abell
Wie die Abbildung 1. veranschaulicht, wird der Markt der Distributionsleistungen im Frische- und Tiefkühlbereich nach dem Konzept von Abell in drei Dimensionen erfaßt. Sie können als Erforschung der Fragen "Was", "Wie" und "Wer" charakterisiert werden (Abell 1980, S. 169-172.):
a) Welche Bedürfnisse der Kunden werden befriedigt - Kundenfunktionen.
b) Wie werden diese Bedürfnisse befriedigt - Technologien.
c) Wer wird durch die Erfüllung der Kundenfunktionen befriedigt - Kundengruppen.
Die ersten zwei Dimensionen beschreiben die Produkte. Die erste und dritte Dimension erlauben die Darstellung der Segmente des relevanten Marktes, indem sie die Kundengruppen und die von den Produkten befriedigten Bedürfnisse der Kunden, d.h. Kundenfunktionen, kombinieren.
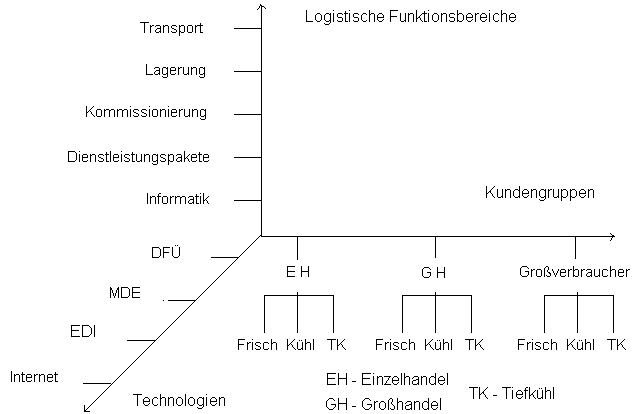
Für die Distribution der temperaturgeführten Produkte spielen das Handling und die Temperatur eine besondere Rolle. Über die Einhaltung der Lückenlosigkeit der Kühlkette wachen zwar zahlreiche Vorschriften, aber ihre Beachtung bleibt eine technische Herausforderung und stößt in der Praxis auf Probleme. Die Kontrolleure rügen, bezogen auf alle Arten von Transportbetreibern in allen Bundesländern, die hygienischen Mängel und "die unverhältnismäßig hohe, unzureichende Kühlung der Lebensmittel", (vgl. o.V. 1996c, S. 59, Zitat von Dr. R. Schünemann, Veterinärdezernentin, Regierungspräsidium Gießen.) und daß es in den "(...) vergangenen drei Jahren keine Verbesserungen, sondern im Gegenteil ein leichter Anstieg der Verstoße festzustellen ist." (vgl. o.V. 1996c, S. 59, Zitat von Dr. R. Schünemann, Veterinärdezernentin, Regierungspräsidium Gießen.) Gerade die Feinverteilung, die ein Spezialgebiet der Eigendistributeure ist, bereitet die meisten Schwierigkeiten, wenn das Kühlfahrzeug mehr als zehn Verkaufsstellen beliefern soll, weil "(...) dann die Temperatureinhaltung wirtschaftlich gesehen kaum mehr garantiert werden kann." (vgl. o.V. 1996c, S. 59, Zitat von F. Leippelt, MUK-Logistik.) Nach TKK-Verordnung muß die Temperatur der Tiefkühlware an "(...) allen Punkten des Produktes mindestens minus 18 Grad betragen." (vgl. o.V. 1996c, S. 59.) Wenn die Tiefkühlprodukte mit Temperatur von -20 Grad angeliefert werden sollen, dann muß man die Kühlaggregate auf -30 Grad einstellen. Nach Erfahrungen von J. Holzer, Leiter der ATP-Prüfstelle, TÜV Bayern Sachsen "(...) haben Fahrzeuge, die nach ATP ausgelegt sind, Schwierigkeiten bei Außentemperaturen von 30 Grad, eine Kühltemperatur von minus 20 Grad zu erreichen." (vgl. o.V. 1996c, S. 59.) Untersuchungen haben ergeben, daß die Kühlaggregate, unzuläßigerweise, bis zu 44% von der ATP-Typprüfung abweichen. Die Bestimmung des K-Werts von Mehrkammerfahrzeugen bereitet um so mehr Probleme, als die Übereinstimmung bezüglich eines Prüfverfahrens zwischen der Bundesrepublik und Frankreich noch nicht erzielt werden konnte. (vgl. o.V. 1996c, S. 59, der internationale Transport der leicht verderblichen Lebensmittel wird in EU von Accord Relatif aux Transports (ATP) geregelt.)
Man kann die Technologie und die logistischen Funktionsbereiche unter die Erfordernisse der Temperatur und des Handling subsumieren. Otto hat die primäre Betätigungsfelder der Distributeure aus der Sicht der Kundengruppe des Einzelhandels in die in der folgenden Übersicht gezeigten Frischdienst-Segmente geteilt. Die Eigendistributeure stehen auf dem Markt der Distribution der temperaturgeführten Produkte im Wettbewerb mit Logistikdienstleistern (Spediteuren), sowie Werkverkehr der Hersteller und des Handels.
|
Segmente aus der Sicht der Dienstleister |
Segmente aus Sicht des Einzelhandels ( WV: Werkverkehr, LDL: Logistkdienstleister, EGD: Eigendistributeur) |
|||||||||||
|
Temperatur |
Innerhalb der Temperatur: Handling |
Tiefkühl |
Obst & Gemüse |
Mopro |
Thekenware |
SB-Ware |
Feinkost |
|||||
|
-28 °C Tiefkühl |
LDL EGD WV |
|||||||||||
|
-2/+2 °C Geflügel |
WV |
WV |
||||||||||
|
2-7 °C FD |
Frischdienst allgemein |
LDL EGD |
LDL EGD |
LDL EGD |
LDL EGD |
|||||||
|
Obst & Gemüse |
LDL EGD |
|||||||||||
|
offene Ware |
WV |
|||||||||||
|
offene, hängende Ware |
WV |
|||||||||||
|
10 °C Räucherwaren |
X |
X |
X |
|||||||||
Allen diesen Distributionssubjekten stehen prinzipiell dieselben Technologien zur Verfügung und sie können potentiell dieselben Kundenfunktionen erfüllen. Nichtsdestoweniger sind die Eigendistributeure geschichtlich gesehen handelsorientiert, während die Spediteure eher mit der Industrie zusammenarbeiten. (vgl. Otto 1996, S. 31f.) Diese Marktstrukturierung zeigt, daß auch die schwierige Tiefkühl-Technologie prinzipiell allen Marktteilnehmern zugänglich ist. Die primären Betätigungsfelder der Marktteilnehmern haben sich dennoch, je nach Kundenfunktion und der hier implizit gewählten Technologie, unterschiedlich herausgebildet. Die Eigendistributeure selbst lassen sich in diesem Zusammenhang in Gruppen aufteilen. So ist die fz-Frischdienst-Zentrale GmbH & Co. in allen Segmenten tätig, während bspw. die W. Kaufmann Frischdienst GmbH & Co KG nicht im Tiefkühlbereich agiert. Die Wilms Tiefkühl-Service GmbH hat sich dagegen auf das Tiefkühl-Segment spezialisiert.